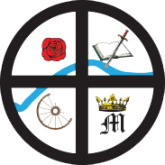Von unserem Seelsorgebereichsmusiker Herrn Auel
Für jeden Organisten ist es wohl eine besondere Freude, einmal im (Berufs-)Leben eine neue Orgel planen zu dürfen. Im Wissen lag aber zumindest zu Beginn viel Wehmut in dieser „Freude“. Die alte Orgel war gute 10 Monate vor dem Brand erst generalüberholt und neu intoniert worden. Das klangliche Ergebnis war für mich wirklich traumhaft, denn vorher konnte man an bestimmten Pfeifen hören, dass sie nicht aus einem Guss für dieses Orgel gefertigt worden waren, sondern aus 4 verschieden Instrumenten unterschiedlichen Alters und Qualität zusammengesetzt waren. Für die meisten von Ihnen wird dies wahrscheinlich nicht hörbar gewesen sein, weil sie die Orgel nicht anders kannten. Verbringt man aber so viele Stunden mit einem Instrument wie wir Organisten, dann lernt man auch die Ecken und Kanten genau kennen. Für eine Orgel aus dieser Zeit war sie vor allem eines, eine sehr zuverlässige Begleiterin. Im Gegensatz zu anderen Instrumenten aus dieser Zeit hatte sie eigentlich nie größere technische Mängel. Somit war es für mich keine wirkliche Freude, als am 3. Mai 2023 das Gutachten den Totalschaden an Pfeifen und Windladen und somit letztendlich der gesamten Orgel bescheinigte.
Langsam kamen die ersten Gedanken auf: Was wird jetzt? Bekommen wir von der Versicherung eine neue Orgel? Denn eines war direkt klar, ohne die Versicherung hätten wir uns eine neue Orgel in der alten Größe nicht leisten können und kleinere Orgeln würde den riesigen Raum nicht adäquat beschallen können. Zum Glück kam die Freigabe der Versicherung relativ schnell, sodass ich mir Gedanken über einen Neubau machen konnte.
Da unser wertvolles Gehäuse restauriert werden kann, war eines von Anfang an klar: Die neue Orgel wird wieder in das alte Gehäuse einziehen und auch zukünftig die Pfeifen beherbergen. Es gibt gerade in unsere Gegend nicht viele Kirchen, in denen ein so wertvolles Gehäuse aus dieser Zeit noch steht. Diesen historischen Schatz gilt es zu bewahren und es gibt viele Beispiele, bei denen ein Neubau in historischem Gehäuse wieder eine ästhetische Einheit bildet.
Aus den Archivunterlagen der Pfarrei konnte die Zusammenstellung der Einzelstimmen (Disposition) der 1793 von den Gebr. Kleine aus Freckhausen für die Franziskanerkirche in Attendorn gebauten Orgel entnommen werden. Dabei stellte sich heraus, dass die Orgel nie fertig gebaut worden war. Man hatte sie für 31 Register auf 2 Manualen und Pedal konzipiert. Realisiert wurden aber aus Kostengründen nur 8 Register im Positiv.
Damit war klar, eine Reorganisation der ursprünglichen Orgel macht keinen Sinn! Zudem muss das neue Instrument bei uns eine große Kirche beschallen können, somit sollte auch die neue Orgelanlage wieder über 3 Manuale plus Pedal verfügen, was natürlich auch das Spektrum der darstellbaren Orgelmusik erheblich erweitert.
In einem barocken Gehäuse sollte natürlich auch ein barocker Klang Einzug halten! Aber will an nur barocke Musik darstellen??? Natürlich nicht! Und so gingen die nächsten Gedanken in Richtung universelles Klangbild aber barock beeinflußt. Ein erster Entwurf sah vor, die vier Teilwerke der Orgel (Hauptwerk, Rückpositiv, Brustwerk und Pedal) wieder so zu disponieren, wie sie vor dem Brand waren, die klanglichen Schwächen aber durch andere Register zu ersetzen.
Nach unzähligen Stunden vor dem Rechner auf der Suche nach einer klanglich ansprechenden Lösung in anderen Pfarreien und einigen Fahrten zu Orgeln, bei denen beispielhafte Lösungen gefunden wurden, kam so langsam Licht in das Dunkel und die Orgel nahm greifbare Gestalt an, soweit man das jetzt schon sagen kann. Denn jede Orgel ist ein Unikat und wird ihren Klang erst aufgebaut in der eigenen Kirche voll entfalten. Erst dann zeigt sich, ob die Vorstellung wirklich Realität wird.
Geplant wurde also ein neues Instrument, mit sehr tragfähigen Grundstimmen, klaren und hellen Flöten, sonore Steicherstimmen, (die in der alten Orgel gar nicht vertreten waren) und kernigen Zungenstimmen nach deutschem und französichem Vorbild, die der Orgel nicht nur die nötige Kraft verleihen, sondern auch als traumhafte Solostimmen zur Verfügung stehen.
Da die techniche Konstruktion für das Rückpositiv äußerst komplex geworden wäre, dieses Werk auch erst 1973 der Orgel beigefügt worden ist und die Sicht auf das wertvolle Hauptwerksgehäuse verhindert, wurde beschlossen, für die neue Orgel kein Rückpositiv mehr einzuplanen und dieses Teilwerk aufzugeben. Zukünftig werden die Stimmen, besonders die Soloregister im neuen Positiv zu finden sein, was im Untergehäuse der Orgel seinen Platz finden wird. Die Grundstimmen können dann hervorragend zur Begleitung von Solisten und Instrumentalisten benutzt werden. Dieses Werk bekommt Schwelltüren, somit kann man den Klang reduzieren und dynamisch beeinflussen, was für all jene besonders angenehm sein wird, die direkt vor dem Gehäuse stehen müssen.
An Stelle des Rückpositives wird die Orgel beim Neubau mit einem französischen Schwellwerk ausgestattet, was hinter dem Gehäuse oberhalb des Pedals platziert werden wird. Durch ein solches Werk wird die Bandbreite der darstellbaren Orgelliteratur erheblich erweitert. Dynamisch gesehen ist ein Schwellwerk ernorm wichtig, da sie einzelne Pfeifen (-Reihen) nach der Intonation nicht mehr in ihrer Lautstärke verändern können. Somit hat man mit Hilfe der Schwelltüren die Möglichkeit, den Gesamtklang zurückzunehmen, sodass ein orchesterähnliches Crescendo oder Decrescendo erzielt werden kann.
Das Hauptwerk bekommt ein breites Fundament an barocken Grundstimmen, aber auch eine Doppelflöte als Soloregister. Dieses ist äußerst selten, wird aber in unsere Akkustik ein traumhaftes Flötenregister werden.
Bei der Namensgebung der Register werden einige Stimmen den Namen bekommen, den auch die Gebr. Kleine beim Bau der Orgel vorgesehen hatten. Somit ist das Hauptwerk eine Reminiszenz an die ersten Erbauer des Werkes, ohne den Anspruch zu erheben, eine historische Kopie zu sein.
Technisch haben wir lange überlegt, in welche Richtung wir planen sollen. Soll eine Orgel, die 2026 gebaut wird, mit einer Spielanlage konstruiert werden, die im 18 Jh. entwickelt wurde? Oder soll ein neues Instrument auch technisch gesehen die Möglichkeiten bieten, die uns heute zur Verfügung stehen? Wir haben uns für letzteres entschieden. Die neue Orgel wird eine elektrische Spiel- und Registertraktur bekommen, dadurch stehen uns Möglichkeiten zur Verfügung, die weit und breit kein weiteres Instrument bietet.
Unsere Orgel wird klangliche Einflüsse aus mitteldeutschen Barockorgeln mit denen der französischen Romantik verbinden, gebaut in der Hellenthal in der Eifel, somit ein länderübergreifendes Instrument, was gerade in einer Zeit entsteht, in der der grenzüberschreitende Gedanken der Freiheit eher in den Hintergrund gerät. Und so hoffe und wünsche ich uns allen, dass die neue Orgel für Kreuzerhöhung Grenzen überschreitet. Nicht nur mit ihrem Klang, sondern auch mit den Menschen (Spielende wie Hörende), die sich von ihrem Klang in den Bann gezogen werden, auf dass die nächsten Generationen voller Freude und Stolz auf ihre Orgel schauen und hören.
Ihr
Andreas Auel